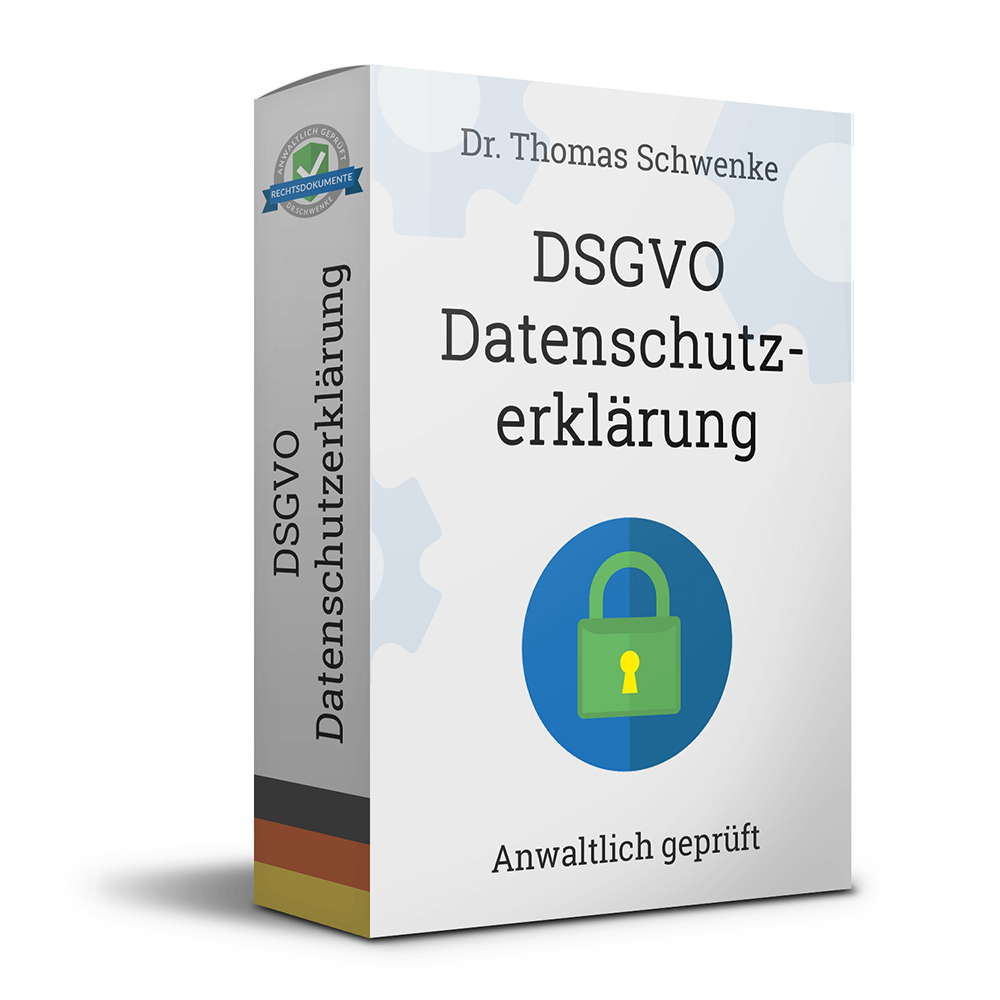Influencervertrag – Erstellung von Inhalten und Promotionsleistungen
Neu: Auch auf Englisch verfügbar
- Rechtssicher und DSGVO-konform: Abmahnsichere Generatorinhalte von Rechtsanwalt und Experten Dr. jur. Thomas Schwenke erstellt.
- Einfach und schnell: In wenigen Minuten zum Influencervertrag – auch ohne juristische Vorkenntnisse.
- Günstig und ohne Abopflicht: Nur 39,90 Euro netto für Geschäftskunden mit unbefristeter Nutzung des Influencervertrages, ein Jahr lang unbegrenzten Updates und das ohne laufende Kosten.
Wann benötige ich einen Influencervertrag?
Die Beauftragung von Influencern birgt viele rechtliche Stolperfallen, deren Missachtung zu Streitigkeiten zwischen Auftraggebern, Agenturen und Influencern führen kann. Mit individuellen Optionen und der Möglichkeit eigener Erweiterungen können Sie Regelungen zu Leistungspflichten, Werbekennzeichnung, Rechteübergang, Vergütung, Verhaltenspflichten, Verschwiegenheit, Datenschutz und Vertragsstrafen treffen und so die Risiken vermeiden.

Hinweise für Berater, Agenturen und Konzerngruppen
Unserer Generator wird gerne von Datenschutzbeauftragten, RechtsanwältInnen oder Agenturen für die Erstellung von Datenschutzerklärungen oder anderen Rechtsdokumenten für ihre Mandanten und Kunden eingesetzt. Wir freuen uns darüber und möchten die Nutzung unseres Generators möglichst einfach gestalten:
Mehr …1. Voraussetzungen
- Eine Lizenz pro Kunde: Sie müssen eine Lizenz pro Kunde erwerben.
- Lizenz für Auszüge: Nutzung von Passagen und Auszügen in anderen Rechtsdokumenten, die Kunden, Mandanten oder anderen Dritten gegenüber angeboten werden, ist ohne den Erwerb einer Lizenz für die Dritten nicht erlaubt.
2. Ihre Rechte
- Erwerb im Namen der Kunden: Sie können unsere Rechtsdokumente im Namen Ihrer Kunden (bzw. Mandanten) erwerben (geben Sie bitte deren Domains/ Unternehmen an).
- Erwerb im eigenen Namen: Sie können unsere Rechtsdokumente auch im eigenen Namen erwerben und bei Ihren Kunden einsetzen (geben Sie jedoch bitte deren Domains/ Unternehmen an).
- Handlingzuschlag ist erlaubt: Sie können Ihren Kunden auch einen Handlingzuschlag berechnen.
- Hinweis nicht erforderlich: Sie müssen Ihre Kunden nicht darauf hinweisen, dass die Rechtsdokumente mit dem Generator erstellt wurden.
- Bearbeitung und Auszüge: Sie können die Rechtsdokumente bearbeiten oder in Teilen verwenden (Falls am Ende ein Siegel/ Hinweis auf Datenschutz-Generator.de verwendet wird, bitte am Ende auf Bearbeitung hinweisen “Bearbeitet von uns” / “Auf Grundlage von”, etc.).
3. Mengenrabatte
- Individuelle Lizenzanfragen: Ab 10 Lizenzen bieten wir Ihnen gerne ein individuelles Lizenzpaket mit zusätzlichen Vorteilen an, bitte kontaktieren Sie uns.
- Konzerne, Unternehmensgruppen und Dachvereine: Für die jeweiligen Tochterunternehmen/ Mitgliedsvereine, etc. mit mehreren Domains, bieten wir Rabatte bis zu 75% an, je nach Volumen.
4. Weitere Hinweise
- Unsere vollständigen AGB und Lizenzbestimmungen.